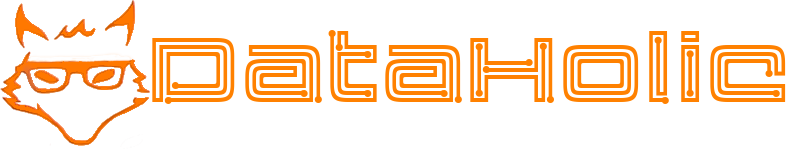Fazit zum MSI MAG X870E Tomahawk Max WiFi PZ (Project Zero)
- Testsystem – Grundlage des Fazits
- Stabilität: Das Board, das einfach läuft
- Design & Project Zero: Aufgeräumt wie ein IKEA-Showroom
- Anschlussvielfalt: PCIe 5.0, M.2 & USB – hier fehlt nichts Wesentliches
- Speicher & RAM-Tuning: DDR5 ohne Nervenzusammenbruch
- BIOS & Tuning: Viele Optionen, wenig Chaos
- Alltagserfahrungen: Gaming, Arbeit und ein Hauch Zukunft
- Thermik & Lautstärke: Kühl bleiben ist Teamarbeit
- Kritikpunkte: Wo Licht ist, ist auch Schatten
- Preis-Leistung und Zielgruppe
- Persönliches Schlusswort
Am Ende des Tests bleibt vor allem ein Eindruck hängen: Das MSI MAG X870E Tomahawk Max WiFi PZ ist eines dieser Mainboards, das man einbaut, kurz die Stirn runzelt – und es danach einfach vergisst, weil es still seinen Job macht. Und genau das ist als Fazit erst einmal ein großes Kompliment. Kein Gezicke beim RAM, keine wilden Spannungsspitzen, kein Drama beim Booten mit einem dicken Ryzen 9 – das Board wirkt erwachsen, solide und erstaunlich unaufgeregt.
Gleichzeitig steckt hier so viel Technik drin, dass man sich zwischendurch dabei ertappt, wie man im BIOS versackt und sich fragt, ob man wirklich jede Option braucht. Aber das ist ein Luxusproblem. Oder um es mit Douglas Adams zu sagen: „Don’t Panic“ – das Tomahawk Max WiFi PZ nimmt einen an die Hand, auch wenn man mal etwas tiefer schrauben will.


Testsystem – Grundlage des Fazits
Bevor wir ins Detail gehen, einmal die Hardwarebasis, auf der alle Eindrücke und Messwerte entstanden sind:
| Hardware | Hersteller / Modell |
|---|---|
| Mainboard | MSI MAG X870E Tomahawk Max WiFi PZ (Project Zero) |
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM | Crucial Pro DDR5 64 GB Kit (4×16 GB) 6000 MHz |
| SSD | Kingston 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| CPU-Kühler | AMD Wraith Cooler |
| Grafikkarte | AMD Radeon RX 6800 XT |
| Netzteil | MSI MPG A1000GS PCIe 5 |
| Tower | MSI MPG Pano 110R PZ |
| Display | LC-M27UFD |
| Tastatur | Dygma Defy |
| Maus | Logitech MX Vertical |
| Mauspad | MSI True Gaming |
Damit decken wir eine klassische High-End-Gaming- und Workstation-Konfiguration ab, wie sie viele Enthusiasten mit Ryzen-9000-CPU und flotter Radeon nutzen würden.
Stabilität: Das Board, das einfach läuft
Stabilität ist langweilig – bis man sie nicht hat. Das X870E Tomahawk Max WiFi PZ hat sich im Test über Stunden mit hoher CPU-Last, Gaming-Sessions und RAM-Tests keinen Ausrutscher geleistet. Das überrascht nicht, wenn man sich die Basis anschaut: ein 14+2+1-Phasen-VRM mit 80-A-Smart-Power-Stages, dualen 8-Pin-EPS-Anschlüssen und einem achtlagigen PCB mit 2-Unzen-Kupfer.
Kurz gesagt: Die Spannungsversorgung ist deutlich über dem, was ein Ryzen 9 9900X im Alltag fordert. Selbst unter Dauerlast blieben die VRM-Temperaturen entspannt, der Luftstrom im Gehäuse war nur moderat und der Wraith-Kühler hatte alle Hände voll zu tun – aber das liegt eher an AMDs Hitzequellen als am Board.
Eine kleine Anekdote aus dem Test: Beim ersten stabilen OC-Profil (leichter All-Core-Boost, leicht angehobene Curve Optimizer-Werte) hätte das Board durchaus zickig werden dürfen. Stattdessen bootete das System, als wäre nichts gewesen. Keine Bootloops, kein Zwangs-CMOS-Reset. Das ist genau das Verhalten, das man von einem „Arbeitsboard“ erwartet, auf das man sich verlassen möchte.
Design & Project Zero: Aufgeräumt wie ein IKEA-Showroom
Das auffälligste Merkmal des Boards ist natürlich das Project-Zero-Design: Die meisten Anschlüsse – 24-Pin-ATX, EPS, SATA, Fan-Header, RGB – sind einfach nach hinten verlagert worden. Im passenden Pano-110R-Gehäuse entsteht dadurch eine Frontansicht, bei der gefühlt nur noch die Hardware selbst sichtbar ist. Kabelsalat? Nur noch ein Thema hinter dem Mainboardtray.
Beim ersten Aufbau fühlt sich das fast falsch an. Man dreht das Board, will den 24-Pin einstecken, und stellt fest: „Falsche Seite.“ Nach zwei, drei Steckern macht es aber Klick. Ab diesem Punkt ist das System so aufgeräumt, dass jede kleine Abweichung sofort auffällt – wie ein Stift, der mitten auf dem blitzsauberen Schreibtisch liegt.
Optisch polarisiert das komplett silberne Layout etwas. Manche lieben den „Raumschiff“-Look, andere hätten sich mehr Kontrast gewünscht. Aber im Zusammenspiel mit dem weißen/silbernen Project-Zero-Case ergibt sich ein sehr homogenes Bild. Die Entscheidung, fast komplett auf RGB am Board selbst zu verzichten, passt gut dazu – hier soll die Hardware glänzen, nicht ein bunter LED-Zirkus.

Anschlussvielfalt: PCIe 5.0, M.2 & USB – hier fehlt nichts Wesentliches
Wer auf ein X870E-Board setzt, erwartet vor allem eins: Zukunftssicherheit. Und die liefert das Tomahawk Max WiFi PZ ziemlich kompromisslos.
- PCIe 5.0 x16 für die Grafikkarte – aktuell noch Luxus, aber spätestens mit der nächsten GPU-Generation spannend.
- PCIe-5.0-M.2-Slot (Lightning Gen 5 x4) für NVMe-SSDs, dazu mehrere M.2-Gen4-Slots mit EZ-M.2-Shield-Frozr-Kühlern.
- USB-Ports mit bis zu 40 Gb/s (USB4 / USB 3.2 Gen 2×2) – praktisch für externe SSDs oder Docking-Stations.
- 5G-LAN (Realtek RTL8126) plus Wi-Fi 7 mit Qualcomm-Modul und Bluetooth 5.4 – Netzwerk seitig ist das Board komplett auf der Höhe der Zeit.
Im Alltag bedeutet das: Selbst wer mehrere schnelle M.2-SSDs, eine dicke Grafikkarte, Capture-Card und ein Audio-Interface betreibt, läuft nicht sofort in Engpässe. Die Lane-Verteilung ist sinnvoll gewählt, die Shared-Bandwidth-Fallen halten sich in Grenzen – wer ein paar Minuten ins Handbuch investiert, weiß schnell, welche Slots sich Ressourcen teilen.
Ein kleines Detail, das in der Praxis Gold wert ist: Die EZ-PCIe-Release-Funktion. Ein kleiner Hebel entspannt das Entfernen der Grafikkarte, ohne dass man mit Schraubenzieher oder Fingerspitze zwischen Kühler und Slot klettern muss. MSI nennt das „EZ PCIe Release“, und es ist einer dieser unspektakulären Punkte, die man erst dann zu schätzen weiß, wenn man zum dritten Mal die GPU umbaut.
Speicher & RAM-Tuning: DDR5 ohne Nervenzusammenbruch
Auf dem Papier unterstützt das Board DDR5-Speicher bis zu 8400 MT/s (OC) und bis zu 256 GB über vier DIMM-Slots. Unser Testkit mit 64 GB bei 6000 MHz ist da eher im soliden Mittelfeld. Entscheidend ist, wie problemlos sich RAM-Profile nutzen lassen.
Die kurze Antwort: XMP/EXPO-Profil geladen, einmal neu gestartet, fertig. Keine langen Boot-Schleifen, keine „Memory Training“-Orgie. Wer mag, kann im BIOS noch an tCL, tRCD und Co. drehen oder die integrierte Memory-Try-It-Funktion nutzen – aber nötig ist das nicht, um ein schnelles und stabiles System zu bekommen.
Schön ist auch, dass MSI bei den RAM-Einstellungen nicht den „Nur für Overclocker“-Weg geht. Die Menüs sind logisch sortiert, und selbst wer nur einzelne Werte anpassen möchte (z. B. SoC-Voltage oder Memory Controller), findet sich relativ zügig zurecht.
Ein Spruch, der dem Gedächtnis hängen bleibt: „Overclocking ist wie Kochen – man muss wissen, was man tut, aber ein gutes Rezept hilft.“ Das BIOS des Tomahawk liefert genau diese Art von Rezept.
BIOS & Tuning: Viele Optionen, wenig Chaos
MSI ist seit Jahren bekannt für seine recht aufgeräumten BIOS-Interfaces, und das X870E Tomahawk Max WiFi PZ bildet keine Ausnahme. Neben einem übersichtlichen EZ-Mode mit den wichtigsten Optionen (Bootreihenfolge, XMP/EXPO, Lüfterkurven, OC-Profile) gibt es den Advanced-Mode, in dem man sich wirklich austoben kann.
Hier finden sich:
- detaillierte Spannungs- und Frequenzoptionen für CPU und RAM,
- Curve-Optimizer-Einstellungen für Ryzen 7000/8000/9000,
- umfangreiche Lüftersteuerung mit mehreren Temperaturquellen,
- Einstellungsmöglichkeiten für PCIe-Konfiguration, Resizable BAR, IOMMU und Co.
Praktisch: Mit einem OC-Engine-Taktgenerator kann das Board Frequenzänderungen sehr fein umsetzen, was vor allem beim Feintuning von Ryzen-CPUs hilft.
Im Test war das BIOS auffällig stabil. Selbst nach Fehlversuchen beim Undervolting reichte in der Regel ein automatischer Neustart mit Default-Werten – der klassische „CMOS-Jumper-Yoga“ blieb aus. Für jemanden, der sein System produktiv nutzt und nicht jeden Tag an den Grenzen der Siliziumphysik kratzt, ist das ein dickes Plus.
Alltagserfahrungen: Gaming, Arbeit und ein Hauch Zukunft
Mit Ryzen 9 9900X und RX 6800 XT ist klar: Grafikkarte und CPU setzen den Ton, nicht das Board. Trotzdem merkt man im Alltag, ob ein Mainboard bremst oder nicht – besonders bei I/O, Ladezeiten und Multitasking.
In Spielen liefert das System die erwartete Leistung: hohe FPS in WQHD und solide Werte in 4K, abhängig vom Titel. Spannend wird es bei Szenarien wie:
- gleichzeitiges Gaming und Aufnahme via OBS auf eine NVMe-SSD,
- Kopieren großer Datenmengen von externer USB-SSD auf interne M.2,
- paralleles Rendern/Encoding im Hintergrund.
Hier spielt das Board seine Stärken aus: Die Kombination aus schnellen M.2-Slots, potenter VRM und reichlich I/O sorgt dafür, dass man selten das Gefühl hat, irgendwo anzustehen. Die Ladezeiten sind kurz, das System bleibt responsiv, während im Hintergrund Dateien geschaufelt werden.
Ein Punkt, der oft unterschätzt wird, ist das Onboard-Audio. Der verbaute Realtek-ALC4080-Codec in Kombination mit MSIs Audio-Boost-Design liefert einen sauberen, klaren Klang – für die meisten Nutzer mehr als ausreichend, solange kein High-End-DAC daneben steht.

Thermik & Lautstärke: Kühl bleiben ist Teamarbeit
Das Board bringt eine ganze Reihe an Kühlfeatures mit: Extended Heatsinks auf den VRMs, M.2-Kühler mit Shield-Frozr-Design und MOSFET-Thermalpads mit hoher Leitfähigkeit. In der Praxis bedeutet das, dass nicht das Board, sondern eher CPU-Kühler und Gehäuselüfter über Lautstärke und Temperatur entscheiden.
Mit dem Wraith-Kühler und einem eher luftigen Lüfterprofil pendelte sich der 9900X unter längerer Last in einem Bereich ein, der für Luftkühlung typisch ist – heiß, aber im Rahmen. Entscheidend: Die VRM-Temperaturen blieben deutlich darunter. Hier zeigt sich, dass MSI beim Design mehr im Sinn hatte als nur ein schickes Datenblatt.
Weil so viele Header auf die Rückseite gewandert sind, wird das Verlegen der Lüfterkabel übrigens etwas anders, aber nicht schwieriger. Einmal verlegt, ist vorn quasi nichts mehr zu sehen – und je weniger Kabel in der Luft hängen, desto weniger stören sie den Luftstrom.
Kritikpunkte: Wo Licht ist, ist auch Schatten
So positiv das Gesamtbild ausfällt, ein paar kleine Punkte bleiben, die man im Fazit nicht unterschlagen sollte.
- Optik ist Geschmackssache Das komplett silberne Design ist mutig. Wer ein klassisch schwarzes Setup gewohnt ist, muss sich daran gewöhnen – oder bewusst zu einem passenden Case und einer hellen Ästhetik greifen. Im falschen Gehäuse kann das Board fast etwas „falsch platziert“ wirken.
- Project Zero braucht das passende Gehäuse Back-Connect ist fantastisch – aber nur, wenn das Gehäuse dafür ausgelegt ist. Ohne Project-Zero-Case ist das Board praktisch nicht sinnvoll nutzbar. Das schränkt die Auswahl ein und macht spätere Gehäuse-Upgrades weniger flexibel.
- Komplexität der BIOS-Optionen Für Einsteiger kann die Menge an Einstellungen erschlagend sein. Die guten Defaults fangen das ab, aber wer unbedingt „mal schnell“ etwas tweaken möchte, verliert sich leicht im Detail. Das ist allerdings eher das Schicksal aller Enthusiasten-Boards.
- Preis im gehobenen Segment X870E-Boards mit USB4, PCIe 5.0 und Project-Zero-Design sind naturgemäß nicht billig. Das Tomahawk Max WiFi PZ positioniert sich im oberen Mittel- bis High-End-Segment – für viele Builds absolut gerechtfertigt, aber nichts für Sparfüchse.
Preis-Leistung und Zielgruppe
Die Frage, ob sich dieses Board lohnt, hängt weniger von technischen Details als von der eigenen Planung ab. Wer:
- auf Ryzen-9000-CPUs setzt,
- PCIe-5.0-GPU und M.2-SSDs perspektivisch nutzen will,
- Wi-Fi 7 und 5G-LAN nicht nur „nice to have“ findet,
- und vor allem Wert auf ein extrem aufgeräumtes System mit Back-Connect legt,
der ist hier ziemlich genau richtig.
Im Vergleich zu noch teureren X870E-Boards mit noch mehr Bling, zusätzlichen Thunderbolt-Controllern oder übertriebenem RGB wirkt das Tomahawk Max WiFi PZ fast schon nüchtern – aber genau dadurch trifft es einen Sweet Spot. Der Fokus liegt auf Stromversorgung, Konnektivität und Alltagstauglichkeit, nicht auf Feature-Overkill.
Es ist ein Board für Leute, die ihren Rechner sowohl zum Spielen als auch zum Arbeiten nutzen, die gern ab und zu im BIOS schrauben, aber nicht jedes Prozent Benchmark-Score hinterherjagen. Oder, um ein oft zitiertes Bonmot aus der IT zu bemühen: „Perfekt ist nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen will.“ Beim Tomahawk Max WiFi PZ fällt einem erstaunlich wenig ein, was man weglassen würde.

Persönliches Schlusswort
Nach einigen Tagen mit dem MSI MAG X870E Tomahawk Max WiFi PZ bleibt ein Fazit, das vielleicht altmodisch klingt: Es ist ein Mainboard, dem man vertraut. Man startet es, installiert sein System, richtet Profile ein – und danach ist es einfach da. Kein Diva-Verhalten beim RAM, kein Gezicke mit der GPU, kein nerviges Netzwerk-Drama.
Das Project-Zero-Design macht den Aufbau sauberer, das System leiser und das Basteln angenehmer. Die VRM-Power ist mehr als ausreichend für aktuelle und kommende Ryzen-Generationen, der Funktionsumfang passt zu einem modernen High-End-System, und die Anschlussvielfalt sorgt dafür, dass man auch in zwei, drei Jahren nicht sofort über ein Upgrade nachdenken muss.
Klar, wer nur einen günstigen Gaming-PC baut, kann mit einem B- oder X-Chipsatz eine Stufe darunter glücklich werden. Aber wenn der Rechner gleichzeitig Arbeitsplatz, Spieleplattform und Experimentierfeld ist, dann spielt das Tomahawk Max WiFi PZ seine Stärken aus.
Oder ganz kurz: Wer bereit ist, den aufgerufenen Preis zu zahlen und das passende Project-Zero-Gehäuse einplant, bekommt ein extrem solides, zukunftssicheres und angenehm unauffälliges Herzstück für den nächsten PC.
Hinweis gemäß EU-Vorgaben zur Transparenz:
Die in diesem Testbericht vorgestellte MSI MAG X870E Tomahawk Max WiFi PZ wurde uns von MSI als unverbindliche Leihgabe zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei nicht um bezahlte Werbung.
MSI hatte keinerlei Einfluss auf Inhalt, Bewertung oder redaktionelle Unabhängigkeit dieses Artikels. Alle geäußerten Meinungen basieren ausschließlich auf unseren eigenen Praxiserfahrungen.
Wir bedanken uns herzlich bei MSI für die Bereitstellung des Mainboards und das entgegengebrachte Vertrauen in dataholic.de.